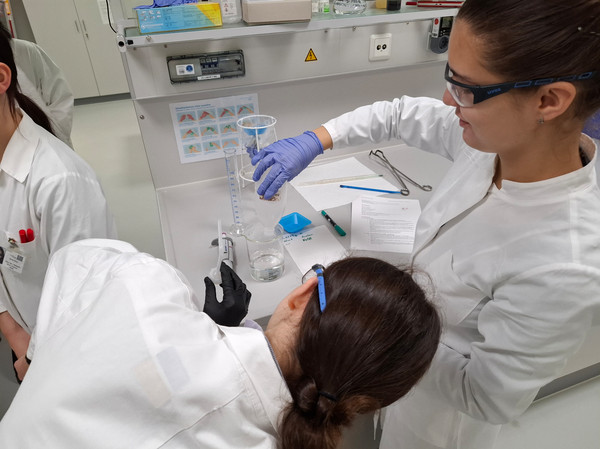Mit Physik gegen Krebs und chronische KrankheitenInterview mit Dr. Theresa Staufer wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Hamburg
Mit 15 wollte sie Physikerin werden. 15 Jahre später ist sie genau das geworden: Theresa Staufer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Experimentalphysik an der Uni Hamburg. Die offizielle Berufsbezeichnung verrät allerdings nicht viel über den Alltag der gebürtigen Österreicherin und schon gar nicht, dass sie direkt im Anschluss an ihre Promotion einen unbefristeten Arbeitsvertrag unterschreiben durfte – an Hochschulen eher die Ausnahme als die Regel. Sie sei zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, sagt die 31-jährige bescheiden. Dabei wird im NAT Gespräch deutlich, dass es viel mit Neugierde und Fortschrittsglaube, aber auch mit Mutmachern unter ihren Lehrkräften zu tun hat, dass Theresa Staufer ihre ländlich geprägte Heimat verlassen hat, um den Dingen zielstrebig auf den Grund zu gehen.
NAT: Was hat sie schon als Teenager an der Physik fasziniert?
Theresa Staufer: Alles was mit dem Thema Röntgenstrahlung zu tun hat, fand ich schon immer super faszinierend. Ohne Operation ins Innerste des Körpers hineinschauen zu können – ich wollte verstehen, wie das funktioniert. Physik kann alltägliche Phänomene erklären. Was es beispielsweise für einen Unterschied macht, ob wir mit 130 oder 160 Stundenkilometern über die Autobahn rasen. Meine Physiklehrer waren sehr gut darin, praktische Beispiele zu geben und auch die Theorie anschaulich rüberzubringen. Ohne guten Schulunterricht hätte ich den Weg in die Physik nicht eingeschlagen.
NAT: Wie hat Ihr Umfeld darauf reagiert?
Staufer: Meine Eltern waren total offen, sie haben mir nicht reingeredet, sondern mich ermuntert, zu machen, was mir Spaß macht. Interessen sind wichtiger als Geld und Karriere, meinten sie. Mit Physik und Wissenschaft hat unsere Familie allerdings bisher nichts zu tun gehabt und viele andere reagierten eher irritert, fragten, was ich mit Physik anfangen wollte und ob ich nicht wenigstens auf Lehramt studieren könnte. Aber ehrlich gesagt hat mich das wenig gejuckt. Für mich war klar, ich würde nicht im Dorf bleiben, sondern erst einmal in eine große Stadt ziehen. Nach wie vor werde ich gefragt, was ich mache, wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch bin – und keiner kann sich das so richtig vorstellen.
NAT: Versuchen Sie es uns doch einmal zu erklären.
Staufer: Wir kümmern uns um die Weiterentwicklung der Röntgenfluoreszenz-Bildgebung, einer Methode, die besonders in der Medizin oder Pharmazie Anwendung findet. Ein Beispiel ist das Co-Enzym Q10, dessen Aufnahme in Hautzellen wir sichtbar machen konnten. Dafür haben wir Q10-Moleküle zunächst mit Jod markiert, Hautzellen damit behandelt und anschließend mit einem ganz feinen Röntgenstrahl abgescannt. Immer dann, wenn der Röntgenstrahl auf die Jodmoleküle trifft, werden spezielle Signale ausgesendet, die wir messen können. Das Spannende, was wir herausfinden konnten: Jede einzelne Zelle hatte das Enzym aufgenommen und wir konnten eine klare Korrelation zwischen der Größe der Zelle und der Menge des aufgenommenen Enzyms nachweisen.
NAT: Das klingt schon sehr nach medizinischer Forschung…
Staufer: Nein, wir machen nur die Physik. Unsere Kooperationspartner markieren die Zellen und wir sind diejenigen, die den Messaufbau planen und die Röntgenquelle modifizieren: Wo positioniere ich in welchem Abstand und unter welchem Winkel die Detektoren, um die Signale messen zu können. Das ist reine Physik, ohne die medizinische Bildgebungsmethoden niemals funktionieren würden: Man muss eine Röntgenquelle bauen und wissen, wie Signale generiert und gemessen werden. Aber dass ich so interdisziplinär arbeiten kann, finde ich sehr spannend.
NAT: Wie sind Sie zum Institut für Experimentalphysik gekommen?
Staufer: Ich habe mein Bachelorstudium in Wien an der Technischen Uni gemacht, aber relativ schnell gemerkt, dass ich lieber anwendungsbezogener arbeiten möchte, am liebsten an einem größeren Forschungszentrum. Da hat sich relativ schnell Hamburg herauskristallisiert, weil es hier eine sehr gute Infrastruktur für die Physik gibt und mich immer schon die Schnittstelle zur Medizin interessiert hat, also wie funktioniert eine CT-Aufnahme oder auch ein MRT. In Hamburg konnte man den Schwerpunkt medizinische Physik im Masterstudiengang wählen.
NAT: Aber ein Medizinstudium kam für Sie nicht in Frage?
Staufer: Ich kann kein Blut sehen – insofern bin ich als Ärztin nicht geeignet und auf der Technikseite richtig aufgehoben. In der Medizin diagnostiziert man und heilt im besten Fall irgendwelche Krankheiten. In der Physik gehen wir den Dingen stärker auf den Grund und wollen jedes einzelne Detail verstehen. Etwas hinnehmen, nur weil es funktioniert und zur Routine machen, das genügt uns nicht, wir wollen weiter gehen. Das wissenschaftliche Arbeiten ist richtig cool, man arbeitet in Gruppen und hat die Freiheit, eigene Ideen umzusetzen. Im Studium lernt man, komplexe Sachverhalte einfach zu beschreiben und Schritt für Schritt zu verstehen und gemeinsam zu lösen.
NAT: Und nach dem Studium? Was zeichnet ihren Berufsalltag aus?
Staufer: Ich habe viele Besprechungen, auch digital. Das hat den Vorteil, dass wir auch mit unseren Kooperationspartnern z.B. in Japan oder in den USA unkompliziert sprechen können. Es geht immer darum, wie wir unsere Methode weiter entwickeln und etwa für die Krebsforschung nutzen können. Dafür sind wir im Austausch mit dem UKE und betreuen viele Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten. Ein bis zwei Tage bin ich auch selbst im Labor tätig, im Semester gebe ich Lehrveranstaltungen, in den Semesterferien bin ich auf Konferenzen und Dienstreisen unterwegs. Es ist sehr abwechslungsreich, ich komme mit Menschen aus aller Welt zusammen und kann die Forschung aktiv vorantreiben. Die Methode der Röntgenfluoreszenz-Bildgebung in die klinische Anwendung zu bringen, das ist das übergeordnete, das ganz große Ziel.